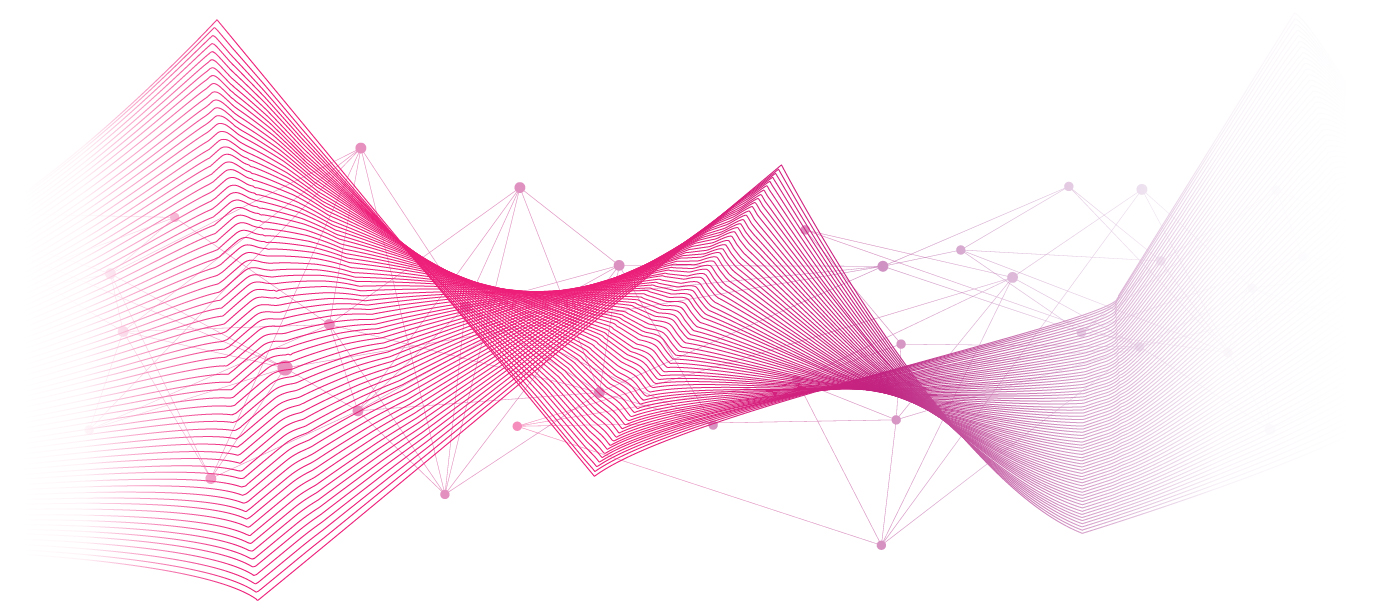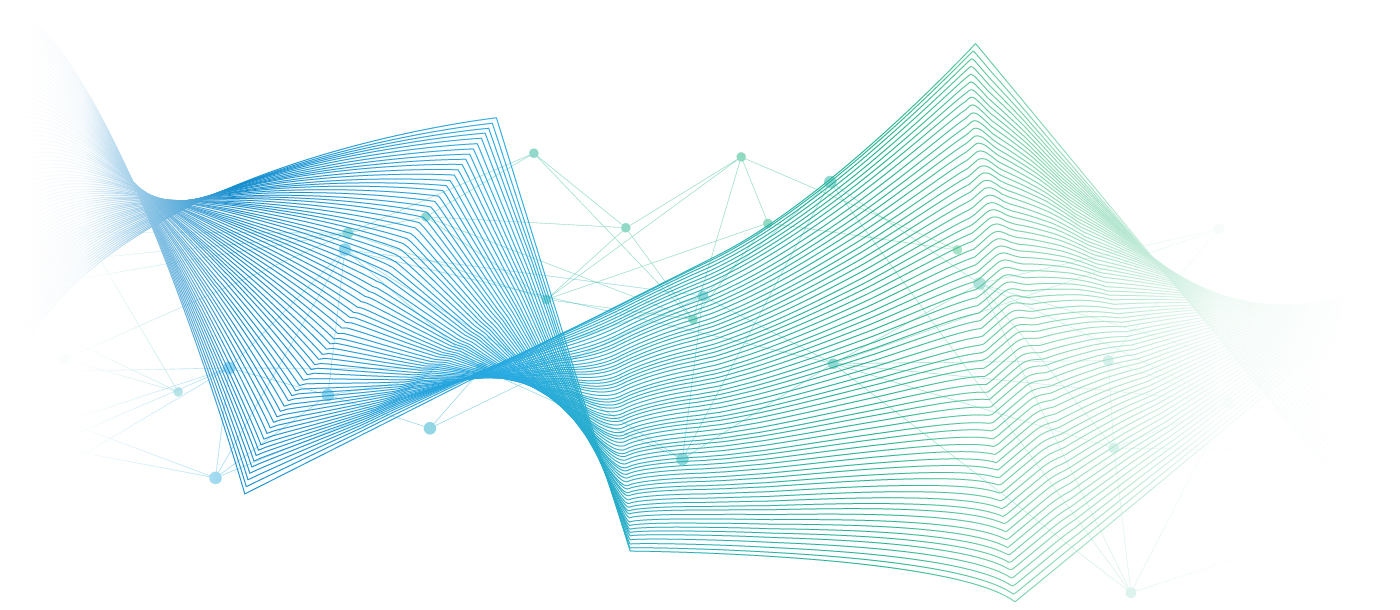Ein weiterer Button im E-Commerce: Die „Widerrufsfunktion“ wird verpflichtend (Teil 1/2)

Hintergrund
Seit 1. August 2011 gilt – in Umsetzung der Vorgaben aus der Verbraucherrechte-Richtlinie (kurz „VRRL“) 2011/83/EU – die sogenannte „Button-Lösung“ (heute § 312j BGB), die Verbraucher:innen vor Kostenfallen im E-Commerce schützen soll: Am Abschluss des Bestellvorgangs müssen unter anderem alle zu zahlenden Preise und Kosten direkt über dem Bestell-Button stehen und dieser muss mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder ähnlich eindeutig beschriftet sein.
Seit 1. Juli 2022 müssen in Deutschland Unternehmen, die im E-Commerce „über eine Website“ entgeltliche B2C-Verträge mit längerer Laufzeit abschließen, Verbraucher:innen ermöglichen, solche Verträge auch online zu kündigen. Sie müssen auf der Website eine sinngemäß mit „Verträge hier kündigen“ beschriftete Schaltfläche (den „Kündigungs-Button“) platzieren, die zu einer Seite führt, auf man eine Kündigungserklärung online abgeben kann (wie berichteten über diese und weitere im Jahr 2022 in Kraft getretene Änderungen im Verbraucherschutzrecht und E-Commerce-Recht).
Von dieser Regelung hat sich offenbar die Europäische Union anregen lassen. Die EU-Kommission hatte in ihrem Vorschlag für eine Richtlinie zu im Fernabsatz geschlossenen Finanzdienstleistungsverträgen (im Folgenden: die „Richtlinie“) vorgesehen, dass Finanzdienstleister für online abgeschlossene Finanzdienstleistungsverträge eine „Schaltfläche für den Widerruf“ („Widerrufs-Button“) bereitstellen müssen. Um „die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts“ zu gewährleisten, dürfe „das Verfahren für die Ausübung dieses Rechts nicht aufwendiger sein als das Verfahren für den Abschluss des Fernabsatzvertrags“.
Im Gesetzgebungsverfahren weitete der Rat der Mitgliedstaaten die Pflicht, eine solche – jetzt „Widerrufsfunktion“ genannte – Möglichkeit zum Abgeben einer Online-Widerrufserklärung zu schaffen, auf sämtliche Verbraucherverträge im E-Commerce aus.
In die „Verbraucherrechte-Richtlinie“ 2011/83/EU (kurz „VRRL“) wird ein neuer Artikel 11a eingefügt, dessen Absatz 1 Unterabsatz 1 lautet:
„Bei Fernabsatzverträgen, die über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen werden, stellt der Unternehmer sicher, dass der Verbraucher den Vertrag auch widerrufen kann, indem er eine Widerrufsfunktion benutzt.“
Anwendungsbereich
Relevant ist der neue Button, während die Richtlinie (EU) 2023/2673 ihrem Titel entsprechend ansonsten nur Finanzdienstleistungsverträge betrifft, wie die beiden anderen Buttons für den gesamten E-Commerce mit Verbraucher:innen, also zum Beispiel Online-Händler oder Anbieter von digitalen Diensten wie Nachrichten-Portale, Zeitschriften-Datenbanken, Webinare, E-Learning-Plattformen etc.
Der Ausdruck „Online-Benutzeroberfläche“ (englisch „online interface“) bedeutet dasselbe wie „Online-Schnittstelle“ (englisch ebenfalls „online interface“) in der Verordnung (EU) 2022/2065 („Digital Services Act“, kurz „DSA“ – wir berichteten: https://www.lausen.com/blog/der-digital-service-act-neue-pflichten-fuer-hosting-diensteanbieter/), nämlich „eine Software, darunter auch Websites oder Teile davon sowie Anwendungen, einschließlich Mobil-Apps“ (Art. 3 Buchst. m DSA). Auch M-Commerce, etwa der Einzelkauf von Ausgaben oder der Abschluss eines E-Paper-Abonnements in einer Zeitungs-App, ist daher erfasst.
Dass im Handstreich aus einer sehr speziellen Regelung eine Regelung mit so großer Reichweite gemacht wurde, rief berechtigte Kritik hervor (siehe etwa die gemeinsame Stellungnahme des BITKOM und weiterer Verbände vom 21. Februar 2023).
Zudem hatten Unternehmen erst 2022 aufgrund der Richtlinie (EU) 2019/2161 „zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der Union“ Änderungen beim Widerrufsrecht umzusetzen. In der gesetzlichen Vorlage für Widerrufsbelehrungen war bei der Aufzählung von Beispielen für eine Widerrufserklärung („ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail“) das Telefax weggefallen und in der Widerrufsbelehrung und im Muster-Widerrufsformular bei den Kontaktdaten des Unternehmens keine Telefaxnummer mehr vorgesehen – allein wegen dieser dringenden „Modernisierung“ mussten alle im Fernabsatz tätigen Unternehmen ihre Texte zum Widerrufsrecht überarbeiten.
Anforderungen an die Widerrufsfunktion
Den Ausdruck „Widerrufsfunktion“ verwendet der Gesetzgeber leider nicht eindeutig.
- Zum einen ist damit eine (mit einem Hyperlink zu einer Eingabeseite hinterlegte) Schaltfläche (der eigentliche „Widerrufs-Button“) gemeint, zum Beispiel in Art. 11a Abs. 1 Uabs. 2 VRRL-neu, der regelt, wie die „Widerrufsfunktion“ beschriftet sein muss.
- Zum anderen ist damit eine Eingabeseite bzw. das dort befindliche Eingabeformular gemeint, etwa in Art. 11a Abs. 1 UAbs. 1 VRRL-neu („widerrufen […], indem er eine Widerrufsfunktion nutzt“) und ganz klar in Art. 11a Abs. 2 VRRL-neu („Die Widerrufsfunktion ermöglicht es […], eine Online-Widerrufserklärung zu versenden“).
Erwägungsgrund 37 der Richtlinie erläutert:
„Um das Verfahren zu vereinfachen, könnte der Unternehmer beispielsweise Hyperlinks bereitstellen, über die der Verbraucher zur Widerrufsfunktion gelangt.“
Sowohl der Verweisanker (Schaltfläche) wie auch das Verweisziel des Hyperlinks (Eingabeseite) werden als „Widerrufsfunktion“ bezeichnet, was den Verfassser:innen der Richtlinie spätestens an dieser Stelle eigentlich hätte auffallen müssen.
Vorgaben für die Schaltfläche
Zunächst muss die Widerrufsfunktion (hier gemeint: die Schaltfläche) nach Art. 11a Abs. 1 UAbs. 2 VRRL-neu „gut lesbar mit den Worten ‚Vertrag widerrufen‘ oder einer entsprechenden eindeutigen Formulierung gekennzeichnet“ sein.
Wie beim Bestell-Button nach Art. 8 Abs. 2 UAbs. 2 VRRL wird die Beschriftung der Widerrufsfunktion durch Art. 11a Abs. 1 UAbs. 2 VRRL-neu nicht alternativlos vorgegeben. Auch „Widerruf erklären“ oder „Widerrufsrecht ausüben“ sind denkbar; der Begriff „Widerruf“ wird sich indes kaum hinreichend eindeutig umschreiben lassen.
Dass die Widerrufsfunktion (d. h. die Schaltfläche) „auf der Online-Benutzeroberfläche hervorgehoben platziert und für den Verbraucher leicht zugänglich“ sein muss, dürfte wie die Anforderung „leicht erkennbar“ (§ 5 TMG) beim Hyperlink zum Impressum so zu verstehen sein, dass der – eindeutige Linktext – auch gut auffindbar sein muss. Die Schaltfläche sollte dort untergebracht werden, wo durchschnittliche Nutzer:innen Links zu rechtlich relevanten Texten wie Impressum, AGB und Datenschutzerklärung vermuten.
Ob angesichts des prädikativen Zusatzes „hervorgehoben“ auch eine besondere visuelle Gestaltung vonnöten ist, sodass dieser Link stärker ins Auge fällt als etwa der Link zum Impressum, ist unklar.
Vorgaben für die Eingabeseite
Sodann verlangt Art. 11a Abs. 2 VRRL-neu:
„Die Widerrufsfunktion ermöglicht es dem Verbraucher, eine Online-Widerrufserklärung zu versenden, mit der der Unternehmer von der Entscheidung des Verbrauchers, den Vertrag zu widerrufen, in Kenntnis gesetzt wird.“
Hier ist mit „Widerrufsfunktion“ nun die Eingabeseite (in § 312k Abs. 2 BGB beim Kündigungs-Button als „Bestätigungsseite“ bezeichnet) gemeint – oder genauer gesagt das Eingabeformular mit Absende-Button.
Der:die Verbraucher:in soll „über [sic!] diese Online-Widerrufserklärung“ bestimmte Informationen (Name, Identifizierung des zu widerrufenden Vertrags, elektronisches Kommunikationsmittel zur Übermittlung der Eingangsbestätigung) „bereitstellen oder bestätigen“ können.
Dabei kann die Möglichkeit genutzt werden, die Eingabefelder mit im Kundenkonto vorhandenen Daten vorzubelegen; dann muss der:die Verbraucher:in die betreffenden Angaben in der Tat nur mehr „bestätigen“. Im Wortlaut von Art. 11a Abs. 2 VRRL-neu findet das keinen Niederschlag, aber in den Erwägungsgründen der Richtlinie heißt es dazu in Erw. 37:
„So sollte ein Verbraucher, der sich bereits (etwa durch Einloggen) identifiziert hat, den Vertrag widerrufen können, ohne sich oder gegebenenfalls den Vertrag, den er widerrufen möchte, erneut identifizieren zu müssen.“
Es ist zu wünschen, dass der deutsche Gesetzgeber zu dieser Vorgabe eine ausdrückliche Regelung schafft, also beispielsweise bestimmt, dass der Name (soweit bekannt) bei einem:einer eingeloggten Verbraucher:in nicht unnötig abgefragt werden darf.
Übermittlung der Widerrufserklärung
Schließlich muss der:die Verbraucher:in die vorbereitete Online-Widerrufserklärung mittels einer mit den Worten „Widerruf bestätigen“ (oder gleichwertig) gekennzeichneten „Bestätigungsfunktion“ (sprich: Absende-Button) abgeben können.
Dem:der Verbraucher:in ist unverzüglich eine Eingangsbestätigung zu übersenden, die den Inhalt der Widerrufserklärung sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs enthält, und zwar „auf einem dauerhaften Datenträger“ (nach Art. 2 Nr. 10 VRRL umfasst das auch elektronische Nachrichten, also am einfachsten per E-Mail).
Widerrufsfunktion neben bereits bestehenden Erleichterungen zur Ausübung des Widerrufsrechts
Das alles erfordert einigen Aufwand für die Gestaltung und Programmierung des Eingabeformulars und ist wie gezeigt auch mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden.
Dabei sind Unternehmen beim Fernabsatz schon jetzt verpflichtet, Verbraucher:innen das gesetzliche Muster-Widerrufsformular gemäß Anlage 2 zum EGBGB auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.
Das frühere Rückgaberecht, das durch schlichtes Zurücksenden der Ware ausgeübt wurde, musste der deutsche Gesetzgeber übrigens 2014 bei der Umsetzung der VRRL streichen, weil die VRRL zwingend eine „Erklärung“ des:der Verbraucher:in über die Ausübung des Widerrufsrechts vorsieht – nur deswegen wurde zugleich die neue Pflicht geschaffen, die Verbraucher:innen durch Bereitstellung des Muster-Widerrufsformulars bei der Formulierung dieser Erklärung zu unterstützen …
Die Bereitstellung der Widerrufsfunktion macht das Übersenden des Muster-Widerrufsformulars im E-Commerce aber nicht entbehrlich; den Verbraucher:innen steht frei, auch auf einem anderen Weg zu widerrufen.
Wichtig: Auch wer Verbraucher:innen schon jetzt überobligatorisch die gesetzlich vorgesehene Option einräumt, die Widerrufserklärung online abzugeben, muss trotzdem – zusätzlich oder stattdessen – die neue Widerrufsfunktion bereitstellen. In Erw. 37 der Richtlinie heißt es, dass die Widerrufsfunktion „neben anderen vorhandenen Widerrufsoptionen“ eingerichtet werden soll. Die Vorgaben zur Widerrufsbelehrung im neugefassten Anhang I der VRRL zeigen besonders deutlich, dass es sich für den Gesetzgeber um zwei verschiedene Dinge handelt: Danach muss ein Unternehmen im E-Commerce künftig in der Widerrufsbelehrung sowohl über die (gesetzlich verpflichtende) „Funktion […], mit der der Verbraucher den online geschlossenen Vertrag widerrufen kann“ als auch – gegebenenfalls – über die (freiwillig eingeräumte) „Wahl […], die Information über seinen Widerruf des Vertrags auf Ihrer Webseite elektronisch auszufüllen und zu übermitteln,“ informieren.
Der zweite Teil des Beitrags beschäftigt sich mit rechtlichen Unsicherheiten bei der praktischen Ausgestaltung der Widerrufsfunktion.